Stärkere Licht-Materie-Wechselwirkung vorantreiben: Zinn-Nanoantennen als neue plasmonische Plattform
Forschende der TU Chemnitz haben einen neuen Ansatz entdeckt, um die Licht-Materie-Kopplung in Graphen mithilfe von Zinn-Nanoantennen zu verstärken – Ergebnisse wurden in „Advanced Optical Materials“ veröffentlicht
-
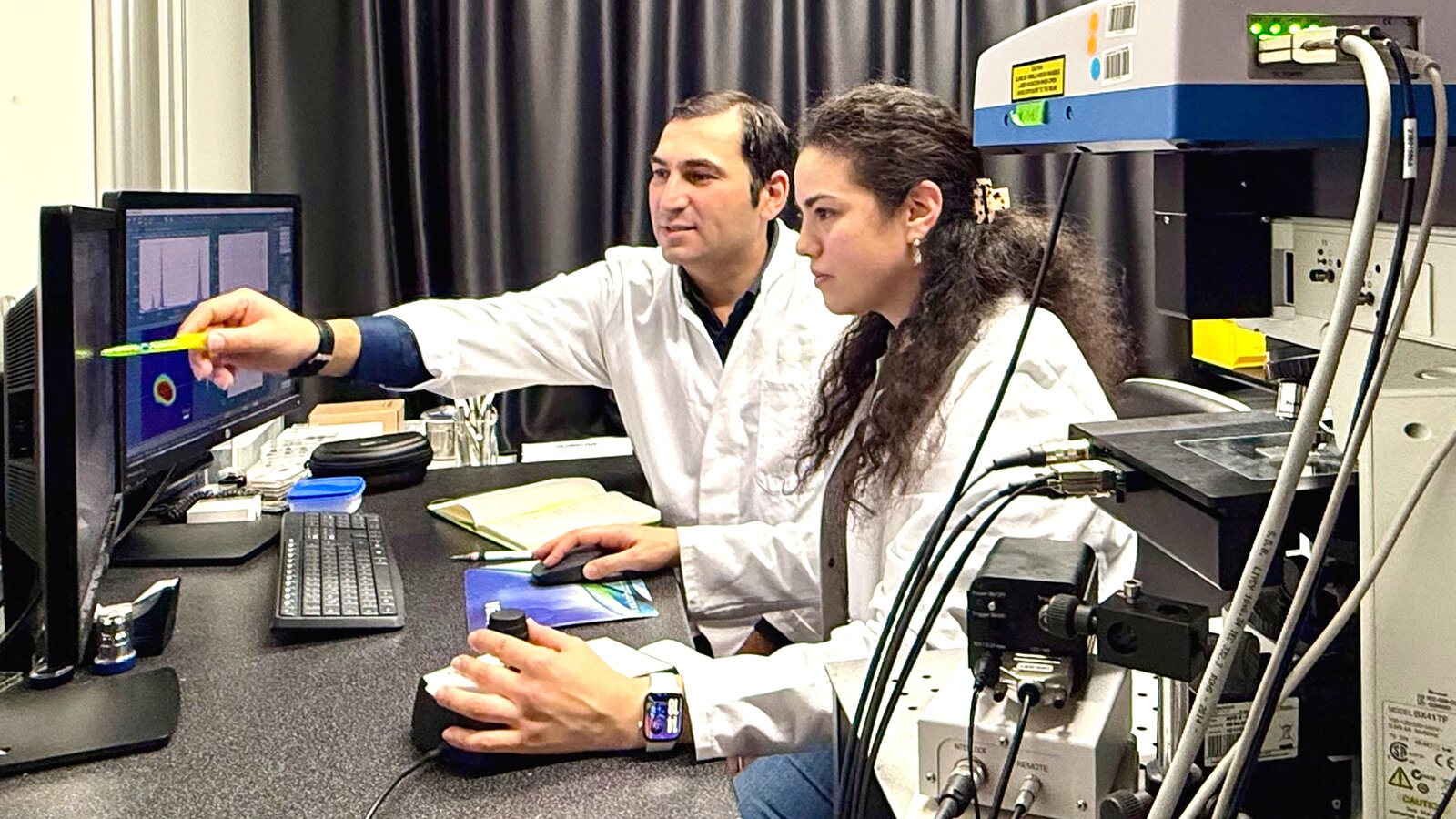
Dr. Zamin Mamiyev von der Professur Analytik an Festkörperoberflächen und Dr. Narmina Balayeva von der Professur Halbleiterphysik der TU Chemnitz werten gemeinsam die Ergebnisse von Experimenten aus. Foto: Dr. Septila Renata
Die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte und von der Technischen Universität Chemnitz koordinierte Forschungsgruppe „Proximity-induzierte Korrelationseffekte in niedrigdimensionalen Strukturen (FOR 5242)“ untersucht, wie Proximitätseffekte und gezielte Grenzflächenmodifikationen in atomar dünnen Materialien zur Entwicklung neuartiger Quanten- und optoelektronischer Bauelemente genutzt werden können. Der Fokus der Forschungsarbeiten liegt auf dem epitaktischen Wachstum und der Interkalation schwerer Elemente der Kohlenstoffgruppe unterhalb von Graphen, um dessen elektronische und optische Eigenschaften zu steuern und hybride Systeme mit verstärkter Licht-Materie-Wechselwirkung zu erzeugen.
In einer aktuellen Publikation im renommierten Fachjournal „Advanced Optical Materials“ berichten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Professuren Halbleiterphysik sowie Analytik an Festkörperoberflächen der TU Chemnitz über einen Durchbruch bei der Kopplung von Licht an Graphen. Die Studie stellt Zinn (Sn) als neues plasmonisches Material vor, das die Wechselwirkung zwischen Licht und zweidimensionalen Materialien deutlich verstärken kann. Dieser Erfolg erweitert das Spektrum plasmonischer Materialien über die üblichen Kandidaten Gold und Silber hinaus und steigert das Potenzial von Graphen für Anwendungen in der Molekülsensorik, in ultraschnellen Photodetektoren und in quantennanophotonischen Bauelementen.
Von der Herausforderung zur Chance: Wie Graphen mehr Licht absorbieren kann
Zweidimensionale Materialien wie Graphen zeichnen sich durch außergewöhnliche mechanische, thermische und elektronische Eigenschaften aus. Insbesondere die fehlende Bandlücke prädestiniert Graphen für breitbandige optische Anwendungen, beispielsweise in Lasern oder abstimmbaren optischen Modulatoren. Trotz dieser Vorteile wechselwirkt Graphen jedoch nur schwach mit Licht: Eine einzelne Graphenlage absorbiert bei senkrechtem Lichteinfall lediglich 2,3 Prozent des sichtbaren Lichts. Diese geringe intrinsische Absorption stellt seit langem eine zentrale Hürde in der Optoelektronik dar.
Ein wirksamer Ansatz zur Überwindung dieser Einschränkung ist der Einsatz plasmonischer Nanoantennen. Das sind metallische Nanostrukturen, die als optische „Trichter“ fungieren. Ähnlich wie eine Radioantenne weit ausgedehnte elektromagnetische Wellen in ein konzentriertes elektrisches Signal bündelt, konvertieren plasmonische Antennen einfallendes Licht effizient in stark lokalisierte Nahfeld-Plasmonenschwingungen. Auf diese Weise entstehen nanoskalige „Hot Spots“, in denen die elektromagnetischen Felder weit über die Beugungsgrenze des Lichts hinaus verstärkt werden. In diesen lokalisierten Bereichen verlaufen elektronische, phononische und molekulare Wechselwirkungen besonders effizient. Das führt zu stark verbesserten optischen Prozessen wie der oberflächenverstärkten Raman-Spektroskopie (SERS), hochempfindlicher Photodetektion oder photocatalytischer Energieumwandlung.
Sn-Nanoantennen: ein neuer Weg zur starken Kopplung
In ihrer jüngsten Arbeit führten die Forschenden Zinn als neuartiges plasmonisches Medium ein. Sie konnten zeigen, dass Sn-Nanoantennen die Raman-Streuintensität der phononischen Moden von Graphen um mehr als zwei Größenordnungen verstärken. „Dieser deutliche Signalgewinn wurde durch die doppelseitige Nähe von Graphen zu Sn-Nanostrukturen, die als plasmonische Nanoantennen wirken, möglich“, erklärt Dr. Narmina Balayeva, Postdoktorandin an der Professur Halbleiterphysik der TU Chemnitz. „Zunächst bildete sich durch Confinement-Epitaxie eine zweidimensionale metallische Zinnschicht zwischen Graphen und dem Siliziumkarbid-Substrat (SiC). Daraufhin wuchsen Sn-Nanoinseln direkt auf der Graphenoberfläche.“
Ein Fenster zu neuer Physik
Die Verstärkung der Licht-Materie-Wechselwirkung dient nicht nur der Leistungssteigerung von Bauelementen, sondern eröffnet auch den Zugang zu neuen quanten- und optophysikalischen Regimen. „Wenn Licht auf atomare Längenskalen konzentriert wird, können sich völlig neue hybride Zustände, sogenannte Polaritonen, bilden, in denen elektronische und optische Anregungen untrennbar miteinander verschmelzen“, erläutert Dr. Zamin Mamiyev, Postdoktorand an der Professur Analytik an Festkörperoberflächen. Er koordinierte die Experimente. „Unter einer derart extremen räumlichen und optischen Konfinement können wir Energieübertragungsmechanismen und Quasiteilchendynamiken untersuchen, die in herkömmlichen makroskopischen Messungen vollständig verborgen bleiben. Dies eröffnet neue Grenzen für Sensorik, Photonik und Quantentechnologien.“
Die Möglichkeit, Materialien Schicht für Schicht zu modifizieren, hat eine neue Ära des „Material-by-Design“ eingeläutet. Heute stehen Hunderte stabiler zweidimensionaler Kristalle zur Verfügung, die sich zu komplexen Heterostrukturen kombinieren lassen. „Durch gezielte Interkalation, also das Einbringen bestimmter Atome zwischen die Schichten, können ungewöhnliche Materialphasen erzeugt und die Wechselwirkungen an den Grenzflächen präzise gesteuert werden“, erläutert Prof. Dr. Christoph Tegenkamp, Inhaber der Professur Analytik an Festkörperoberflächen und Sprecher der DFG-Forschungsgruppe. „Diese bislang einzigartige Kontrolle ermöglicht es, elektronische und photonische Prozesse auf fundamentaler Ebene zu untersuchen und weiterzuentwickeln – eine wesentliche Voraussetzung für zukünftige Hochleistungs-Quantentechnologien.“
Ausblick
Aufbauend auf diesen Ergebnissen plant das Forschungsteam, die plasmonische Antwort der metallischen Nanoantennen und deren Kopplung an Graphen weiter zu optimieren. Durch die präzise Abstimmung dieser hybriden Strukturen soll eine noch stärkere Nahfeldkopplung erreicht werden – ein wichtiger Schritt hin zu neuen Klassen quantenoptischer Materialien und Funktionalitäten. Diese Arbeit unterstreicht die führende Rolle der TU Chemnitz in der Forschung zu 2D-Materialien, Plasmonik und quantennanophotonischen Technologien und schlägt eine Brücke zwischen Grundlagenforschung und den lichtbasierten Technologien von morgen.
Publikation: Enhanced Light–Matter Interactions With a Single Sn Nanoantenna on Epitaxial Graphene; Zamin Mamiyev, Narmina O. Balayeva, Dietrich R.T. Zahn, Christoph Tegenkamp; Advanced Optical Materials
DOI: https://doi.org/10.1002/adom.202500979
Weitere Informationen erteilen Prof. Dr. Christoph Tegenkamp, Telefon 0371 531-33103, E-Mail christoph.tegenkamp@physik.tu-chemnitz.de, sowie Dr. Zamin Mamiyev, Telefon +49 371 531-3170, E-Mail zamin.mamiyev@physik.tu-chemnitz.de
(Quelle: DFG-Forschungsgruppe „Proximity-induzierte Korrelationseffekte in niedrigdimensionalen Strukturen (FOR 5242)“)
Mario Steinebach
24.11.2025





