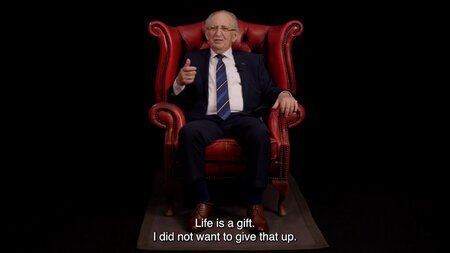Pressemitteilung vom 04.12.1997
Deutscher Zukunftspreis sorgt für freudige Gesichter
Deutscher Zukunftspreis sorgt für freudige Gesichter Mikrospiegel für Laser-TV stammt aus Chemnitzer Uni-Labors Er soll mal so etwas wie ein deutscher Nobelpreis werden, der "Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation". Und weil so ein Name viel zu sperrig ist, haben findige Journalisten ihn flugs "Deutscher Zukunftspreis" genannt. Am vergangenen Freitag wurde der mit 500.000 Mark dotierte Preis in Berlin erstmals verliehen: an Christhard Deter, Chef der Geraer Firma Laser- Display-Technologie (LDT) und Vordenker des Laserfernsehens. Es kommt ohne Bildschirm aus, die Bilder sind gestochen scharf und lassen sich in nahezu beliebiger Größe an die Wand projizieren. Die LDT arbeitet dabei mit mehr als 20 Hochschulen und Instituten zusammen, deren Forschungsergebnisse in das Projekt einfließen. Und ein erklecklicher Teil vom Ruhm des Preises fällt dabei auch für die Chemnitzer Uni ab: Dort nämlich wird eine der beiden wichtigsten Komponenten des Laser-TVs entwickelt, ein Mikrospiegel aus Silizium. Vorgeschlagen werden die Preisträger von einer Reihe renommierter Wissenschaftsorganisationen, darunter der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft und der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Aus allen Vorschlägen wählt eine hochkarätige Jury - darunter Prof. Klaus von Klitzing, Physik-Nobelpreisträger des Jahres 1985 - insgesamt fünf Kandidaten für den Zukunftspreis aus. Neben Deter zählte ein weiterer "Ossie", Prof. Michael Strauss vom Berliner Max-Delbrück-Zentrum, dazu. Am Freitagnachmittag einigte sich die Jury endgültig auf den Preisträger. Bundespräsident Roman Herzog bekam erst während der Verleihung, ganz wie beim Oscar in Hollywood, den Namen in einem verschlossenen Umschlag überreicht. Das besondere an Deter: Als einziger der fünf nominierten Preisträger führt er weder einen Doktor- noch einen Professorentitel im Namen - Vollbluterfinder in der Tradition eines Siemens, Bosch, Zeiss oder von Ardenne brauchen so etwas nicht. Und wie funktioniert das Laserfernsehen nun genau? Es besteht im wesentlichen aus einer Laser-Modulationseinheit und einer Ablenkeinheit. Das Bild selbst setzt sich, wie auch bei normalen Fernsehgeräten und Papierfotos, aus den Farben rot, grün und blau zusammen. Durch Mischung dieser Grundfarben lassen sich alle Farben des Regenbogens darstellen. Die Modulationseinheit wandelt zunächst das ankommende Bildsignal in ein Farbsignal um und steuert außerdem die Intensität der einzelnen Farben. Daneben enthält sie auch noch einen Bildspeicher. Sodann werden die Farben über Lichtwellenleiter zur Ablenkeinheit weitergeleitet. Sie besteht aus zwei Spiegeln und der zugehörigen Steuerelektronik. Die Spiegel werfen das zugeführte Licht dann wie bei einem Kinofilm, nur in besserer Qualität, an die Wand. Diese Spiegel haben Wissenschaftler um Prof. Thomas Geßner und Prof. Wolfram Dötzel vom Chemnitzer Sonderforschungsbereich "Mikromechanische Sensor- und Aktorarrays" entwickelt. Die Bild- und Zeilenspiegel bestehen aus Silizium und sind mit Metall bedampft. Diese Mikrospiegel sind an zwei Stellen beweglich gelagert und können durch das Anlegen einer Spannung ausgelenkt werden. Dabei ist jeder Spiegel einzeln ansteuerbar. Mit dem Array haben die Chemnitzer Wissenschaftler weltweit die Nase vorn. Marktreif ist das Laserfernsehen freilich erst, wenn es gelingt, die Spiegel noch weiter zu verkleinern. Hieran arbeiten die Chemnitzer Forscher zur Zeit mit Hochdruck. Das Scannerarray läßt sich aber auch noch anders einsetzen, etwa als Hohlspiegel mit verstellbarer Brennweite. Auf diese Weise ließe sich ein optisches Radargerät verwirklichen. Auch an eine Materialbearbeitung mit Laserlicht ist gedacht. Da sich das Laserlicht in verschiedenen Ebenen bündeln läßt, wäre dies sogar dreidimensional möglich. Übrigens, wenn Sie sich für den Zukunftspreis interessieren: Das ZDF strahlt die Preisverleihung morgen, am 4. Dezember um 20.15 Uhr in seinem Programm aus - als Wissenschaftsshow der Superlative, mit Forschern, Künstlern, Akrobaten und effektvollen chemischen Experimenten. Moderiert wird die Sendung von Joachim Bublath und Babette Einstmann (Knoff-Hoff-Show, Abenteuer Forschung). (Autor: Hubert J. Gieß) Weitere Informationen: Technische Universität Chemnitz, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Reichenhainer Str. 70, 09126 Chemnitz, Prof. Thomas Geßner, Tel. (03 71) 5 31-31 30, Fax (03 71) 5 31-31 31, e-mail: gessner@infotech.tu-chemnitz.de