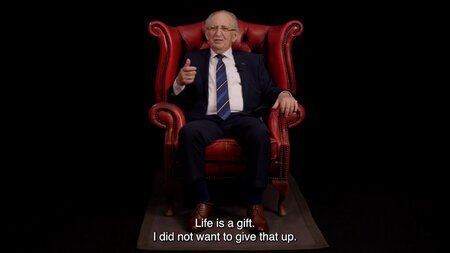Leitfaden zur Planung und Durchführung einer Lebendigen Bibliothek
Wichtig: Die Lebendige Bibliothek ist kein Vortrag, sondern ein dialogisches Format. Im Zentrum stehen persönliche Gespräche mit Expert:innen („lebenden Büchern“), die ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen zu einem bestimmten Thema teilen.
1. Zielsetzung und Veranstaltungsplanung
Definiere zu Beginn das Ziel deiner Veranstaltung: Soll fachliches Wissen vermittelt werden, persönliche Perspektiven zum Thema gesammelt oder ein Dialog zwischen Generationen angestoßen werden?
Lege Zielgruppe, Format (Präsenz, digital oder hybrid), Termin, Dauer und Ort fest – idealerweise barrierefrei und mit Rückzugsorten. Ein klar verteilter Aufgabenplan im Team ist essenziell.
2. Auswahl und Vorbereitung der „lebendigen Bücher“
Die „Bücher“ sind das Herzstück des Formats. Sie sind Menschen, die fundiertes Wissen oder besondere Erfahrungen zu einem thematischen Schwerpunkt mitbringen – z. B. Designer:innen, Produzent:innen, Aktivist:innen oder Handwerker:innen. Ziel ist, Fachwissen in persönlicher Gesprächsatmosphäre zugänglich zu machen.
Die Auswahl sollte vielfältig sein (Alter, Beruf, Hintergrund). Jedes „Buch“ erstellt einen kurzen „Klappentext“, der die individuellen Fachkenntnisse den Leser:innen vorstellt.
Ein Vorbereitungsgespräch hilft, Erwartungen zu klären und Vertrauen aufzubauen. Die „Bücher“ entscheiden selbst, worüber sie sprechen möchten. Auch organisatorische Punkte wie Gesprächsdauer und Pausen werden besprochen.
3. Leser:innen gewinnen und aktivieren
Leser:innen sind die Gesprächspartner:innen der Bücher. Um sie zu gewinnen, ist gezielte Öffentlichkeitsarbeit notwendig – analog und digital. Wichtig ist eine klare Erklärung des Formats, z. B. bei der Begrüßung oder über Flyer.
Besonders wirkungsvoll ist die Lebendige Bibliothek als Begleitformat von Fachveranstaltungen, Messen oder Konferenzen – hier trifft sie auf thematisch interessiertes Publikum, das leicht für einen tiefergehenden Austausch gewonnen werden kann.
Hilfreich hat sich zudem eine kurze persönliche Bühnenvorstellung der Bücher zu Veranstaltungsbeginn erwiesen. Dies schafft Erkennungswert, baut Hemmschwellen ab und motiviert zur Kontaktaufnahme.
Bei Veranstaltungen – etwa Kongressen oder Fachtagen – kann die LTB auch Teilnehmende geplant oder spontan zu lebendigen Büchern machen. Dafür empfiehlt sich eine Abfrage bei der Registrierung: Wer ein Thema oder eine Erfahrung teilen möchte, gibt eine Kurzbeschreibung ab. Diese wird vor Ort sichtbar aufgehängt und signalisiert Gesprächsbereitschaft – z. B. mit einem Button, Namensschild oder an einer Thementafel. So wird das Potenzial der gesamten Veranstaltungsgemeinschaft aktiviert.
4. Raumgestaltung und Ablauf
Ein zentral platzierter Infostand bildet die Anlaufstelle für Interessierte. Die Klappentexte der „Bücher“ sind gut sichtbar ausgestellt und bieten Orientierung. Sie helfen nicht nur bei der Auswahl eines Gesprächspartners, sondern fördern auch das informelle Netzwerken innerhalb der Veranstaltung, da sie persönliche Interessen und Fachhintergründe sichtbar machen.
Die Gespräche finden idealerweise in ruhigen, geschützten Sitzbereichen mit ausreichend Privatsphäre statt. Alternativ können sie auch in ungezwungener Atmosphäre – etwa während Pausen oder im offenen Raum einer Veranstaltung – entstehen.
Alternativ können sie auch in ungezwungener Atmosphäre – etwa während Pausen oder im offenen Raum einer Veranstaltung – entstehen.
Gespräche dauern meist 20–30 Minuten. Ein akustisches Signal oder eine Zeitmoderation erleichtert den Wechsel. Eine leise Moderation im Hintergrund unterstützt den Ablauf und ist ansprechbar bei Fragen.
5. Gesprächsregeln & Schutzkonzept
Ein respektvoller, sicherer Rahmen ist entscheidend. Grundregeln wie Freiwilligkeit, Vertraulichkeit und gegenseitiger Respekt werden zu Beginn vorgestellt und sichtbar ausgehängt. Die Bücher bestimmen selbst, worüber sie sprechen möchten. Rückzugsräume und eine Vertrauensperson sollten bereitstehen.
6. Nachbereitung & Wirkung
Nach der Veranstaltung lohnt sich ein gemeinsamer Rückblick – im Team, mit den Büchern und optional mit Leser:innen. Feedback kann mündlich, schriftlich oder per Online-Formular eingeholt werden. Inhalte (Zitate, Bilder etc.) können – bei Einwilligung – für Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden.
Der Aufbau eines Netzwerks von Büchern kann zur Wiederholung oder Weiterentwicklung des Formats beitragen.
Zusätzliche Hinweise
Pausen und informelle Gesprächsmöglichkeiten (z. B. ein Getränkestand oder eine offene Lounge) fördern Austausch. Mehrsprachigkeit, visuelle Orientierung oder barrierefreie Materialien verbessern Zugänglichkeit. Das Format lässt sich flexibel anpassen – ob als eigenständige Veranstaltung oder als integriertes Begleitprogramm.
Beispiel: Green World Tour Hamburg
Auf der Messe mieteten wir einen kleinen Stand. Vier „Bücher“ aus dem Textilbereich – darunter Designer:innen, Gründer:innen und Fachakteur:innen – standen für Gespräche bereit. Besucher:innen wurden direkt angesprochen, das Konzept erklärt und zum Gespräch eingeladen. Über einen QR-Code konnte online anonym Feedback abgegeben werden.
Unsere wichtigste Erkenntnis: Das Verständnis für das Format ist der Schlüssel. Eine gute Einführung – z. B. durch eine kurze Buchvorstellung auf der Bühne – steigert die Teilnahmebereitschaft deutlich.