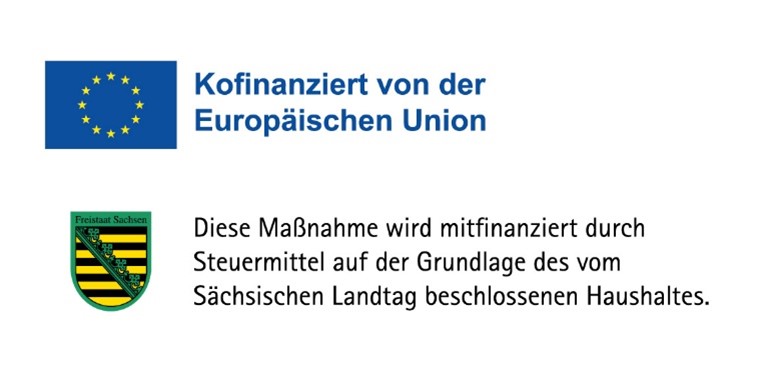Forschungsprojekte
Analyse biopsychosozialer Determinanten innerhalb des Return-to-Work Prozesses von post-COVID Patientinnen und Patienten im Gesundheitsdienst (FR-0358)
Hintergrund
Der Return-to-Work (RTW)-Prozess von post-COVID Patient:innen ist häufig stark beeinträchtigt. Die Heterogenität und Komplexität der post-COVID-Symptomatik stellt insbesondere für Beschäftigte im Gesundheitswesen mit Pflege- und Versorgungsverantwortung eine große Herausforderung für den beruflichen Wiedereinstieg dar.
Die Studienlage zu erfolgreichen RTW-Prozessen bei post-COVID Patient:innen ist bislang heterogen. In aktuellen Studien und Meta-Analysen liegt die RTW-Rate von post-COVID Patient:innen zwischen 47-86% 3 bis 24 Monate nach Akutinfektion.
Zielsetzung
Da individuelle RTW-Verläufe und die damit verbundenen biopsychosozialen, innerbetrieblichen und soziodemografischen Einflussfaktoren bei post-COVID Patient:innen im Gesundheitsdienst mit Pflege- und Versorgungsverantwortung noch unzureichend untersucht sind, adressiert das vorliegende Forschungsprojekt mittels Mixed-Method-Ansatz folgende zentrale Fragestellungen:
- Wie verlaufen betriebliche Wiedereingliederungsprozesse von post-COVID Patient:innen mit Pflege- und Versorgungsverantwortung im Gesundheitswesen?
- Welche individuellen und kontextuellen Bedingungen fördern oder behindern den beruflichen Wiedereingliederungsprozess und somit die Arbeitsfähigkeit von post-COVID Patient:innen mit Pflege- und Versorgungsverantwortung im Gesundheitswesen?
Methodisches Vorgehen
In einer Kohortenstudie mit drei Messzeitpunkten werden betroffene Arbeitnehmer:innen retrospektiv und prospektiv zu ihrem Krankheitsverlauf, Schutz- und Risikofaktoren sowie zur Arbeitsfähigkeit befragt. Die Stichprobe umfasst sowohl (1) Personen mit erfolgreicher beruflicher Wiedereingliederung, (2) Personen, bei denen der RTW-Prozess gescheitert ist als auch (3) Personen, bei denen der RTW-Prozess gegebenefalls geplant sind. Die Datenerhebung erfolgt sowohl quantitativ als auch qualitativ (biographische Verlaufsanalysen).
Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Entwicklung einer digitalen Toolbox ein. Diese soll in der Praxis dazu beitragen, die Arbeitsfähigkeit von post-COVID-Patient:innen differenziert zu bewerten und individuelle Handlungsempfehlungen für Betroffene, Arbeitgeber:innen und Fachkräfte im Gesundheitswesen bereitzustellen.
ProjektmitarbeiterInnen: Dr. Katrin Müller, Marcel Ottiger, Iris Poppele, Prof. Dr. Torsten Schlesinger
Projektlaufzeit: 01.03.2025 bis 31.08.2027
Projektförderer: Forschungsförderung (FR-0358)

ESF Landesinnovationspromotion - Zum Einfluss der bewegungsbezogenen Gesundheitskompetenz auf die habituelle körperliche Aktivität von Patient:innen mit post-COVID
Körperliche Aktivität verringert das Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf und langandauernde Symptome (post-COVID). Die deutsche S1-Leitlinie Long-/Post-COVID empfiehlt gesundheitsförderliche Bewegung gemäß den WHO-Richtlinien als präventive und rehabilitative Maßnahme. Eigene Analysen zeigen allerdings, dass sich nach einer Teilnahme an einer stationären Rehabilitation zwar die körperliche und psychisch-kognitive Gesundheit von post-COVID Patient:innen verbesserte, sich jedoch kein Anstieg des objektiv gemessenen Aktivitätsniveaus zeigte. Ein ganzheitlicher Ansatz zur Förderung von Bewegung ist die bewegungsbezogene Gesundheitskompetenz, die z.B. bei COPD Patient:innen mit einem aktiveren Lebensstil verbunden ist. Studien zu Faktoren, welche die körperliche Aktivität bei post-COVID Patient:innen begünstigen oder hemmen, fehlen bislang.
Das Forschungsprojekt untersucht das körperliche Aktivitätsverhalten von post-COVID Patient:innen und dessen Einflussfaktoren im Zeitverlauf über 12 Monate. Von besonderem Interesse ist hier die Ausprägung der bewegungsbezogenen Gesundheitskompetenz sowie der Einfluss biopsychosozialer Faktoren (z.B. Selbstwirksamkeit, psychische Gesundheit, soziale Unterstützung) und der Arbeitsfähigkeit auf die körperliche Aktivität im Alltag der post-COVID Patient:innen. Das ambulante Assessment als gewählte Untersuchungsmethodik erlaubt intensiv-longitudinale und intraindividuelle mechanistische Untersuchungen in den Lebenswelten der Patient:innen.
Die Ergebnisse des Forschungsprojektes können dazu beitragen, evidenzbasierte Richtlinien für die Konzeption verhaltenspräventiver Maßnahmen bei post-COVID Patient:innen in der Nachsorge zu entwickeln.
ProjektmitarbeiterInnen: Iris Poppele, Dr. Katrin Müller, Prof. Dr. Torsten Schlesinger
Projektlaufzeit: 01.07.2024 - 30.06.2028
Projektförderer: Die Maßnahme ist kofinanziert von der Europäischen Union und wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.